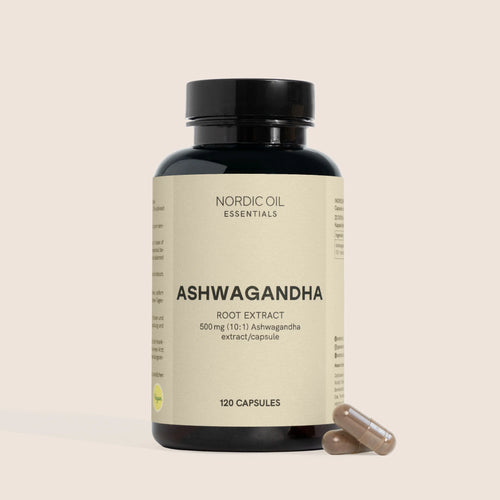MSM bei Migräne: Wirkung und Anwendung im Überblick
Leila WehrhahnAktualisiert: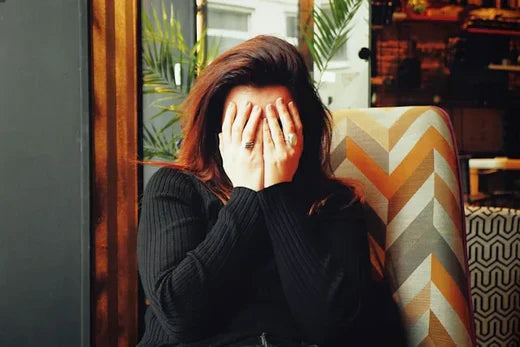
Migräne ist eine häufige neurologische Erkrankung mit wiederkehrenden Attacken, die Alltag und Lebensqualität stark beeinträchtigen können. Viele Betroffene suchen neben der ärztlichen Therapie nach ergänzenden Ansätzen. Dieser Beitrag beleuchtet nüchtern, was über MSM (Methylsulfonylmethan) bei Migräne bekannt ist – inklusive Evidenzstand, praktikabler Anwendungshinweise und Sicherheit.
Die Datenlage zu MSM bei Migräne ist derzeit begrenzt. MSM kann als ergänzende Option erwogen werden – mit ärztlicher Rücksprache, vorsichtigem Dosierungsaufbau und realistischer Erwartung.
Auf einen Blick:
- MSM ist eine organische Schwefelverbindung, die als Nahrungsergänzung genutzt wird; für Migräne ist die Evidenz bislang begrenzt.[1]
- Biologisch plausibel sind antientzündliche Effekte (z. B. Einfluss auf NLRP3-Inflammasom); ein direkter migränespezifischer Nutzen ist noch nicht durch größere RCTs belegt.[2]
- Vorsichtiger Einstieg: niedrig beginnen, langsam steigern, Nutzen nach ca. 8 Wochen anhand eines Tagebuchs prüfen.
- Sicherheitsprofil insgesamt günstig; gelegentlich Magen-Darm-Beschwerden, selten Hautreaktionen oder Kopfschmerzen.[1,3,4]
- Wichtig: Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ärztliche Diagnose oder Therapie. In der EU existieren für MSM keine zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben zu Migräne.[9]
Was ist MSM?
Methylsulfonylmethan (MSM) ist eine natürlich vorkommende Schwefelverbindung. Als Supplement wird MSM vor allem aufgrund möglicher antientzündlicher und antioxidativer Eigenschaften eingesetzt. Klinische Daten zeigen ein insgesamt gutes Sicherheitsprofil bis etwa 4 g/Tag.[1] Für vertiefende Hintergründe zu sportbezogenen Anwendungen verweisen wir auf den Beitrag MSM und Sport.
Grundlagen und mögliche Wirkmechanismen (migräne-relevant)
MSM kann in Zell- und Tiermodellen die Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms dämpfen und proinflammatorische Zytokine reduzieren.[2] Migräne ist u. a. mit neuroinflammatorischen Prozessen verknüpft; daher erscheint dieser Mechanismus grundsätzlich plausibel. Direkte Belege, dass diese Effekte Migräneattacken beim Menschen verlässlich vermindern, fehlen bislang.
MSM könnte Entzündungswege beeinflussen. Ob das Migräneattacken tatsächlich reduziert, ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend belegt.
Migräne kurz erklärt
Was passiert im Körper?
Migräne entsteht durch die Aktivierung des trigeminovaskulären Systems. Dabei werden Botenstoffe wie CGRP freigesetzt, die Gefäße der Hirnhäute erweitern, Schmerzen verstärken und eine sterile Neuroinflammation fördern.[6,7] Dies kann eine Sensibilisierung von Nervenbahnen auslösen und die Schmerzverarbeitung im Gehirn verändern.[6–8]
Migräne ist eine neurovaskuläre Erkrankung: Trigeminusaktivierung, CGRP-Freisetzung und Entzündungsprozesse spielen zusammen.
Trigger und Abgrenzung zu Spannungskopfschmerz
Häufige Trigger sind Stress, Schlafmangel, unregelmäßige Mahlzeiten, bestimmte Hormonschwankungen und sensorische Reize. Im Unterschied dazu ist der Spannungskopfschmerz meist beidseitig, drückend, eher leicht bis mittelstark und wird durch körperliche Aktivität nicht verstärkt; Übelkeit oder starke Licht-/Lärmempfindlichkeit fehlen typischerweise.[6,8]
Was sagt die Forschung zu MSM bei Migräne?
Zur migränespezifischen Wirksamkeit von MSM liegen derzeit nur sehr wenige und keine großen, hochwertigen randomisierten Studien vor. Es gibt RCTs zu MSM bei anderen Schmerz- oder Belastungsmodellen (z. B. Arthrose, sportinduzierter Schmerz), die teils Verbesserungen, teils keine signifikanten Effekte zeigen.[3,4] Diese Ergebnisse sind jedoch nicht ohne Weiteres auf Migräne übertragbar.
Studienübersicht
| Studie | Design | n | Dauer | Endpunkte | Ergebnis | Limit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osteoarthritis-Knie[3] | RCT, doppelblind | 50 | 12 Wo. | Schmerz, Funktion | Verbesserungen vs. Placebo | Keine Migränepopulation |
| Halbmarathon-Belastung[4] | RCT, doppelblind | 24 | ~4 Wo. | Schmerz, Marker | Trends, meist nicht signifikant | Klein, sportbezogen |
| Mechanistik: NLRP3[2] | In vitro | – | – | Inflammasom-Aktivierung | Hemmung nachgewiesen | Nicht klinisch |
Wissenslücken
Es fehlen randomisierte, placebokontrollierte Studien mit Migräne-Betroffenen, die Migränetage/Monat (MMD), Attackenschwere, Bedarf an Akutmedikation und Lebensqualität als Hauptendpunkte prüfen. Bis solche Daten vorliegen, bleibt die Einschätzung zurückhaltend.
Aktuell gibt es keine robusten RCTs zu MSM bei Migräne. Indirekte Hinweise aus anderen Schmerzsettings reichen nicht für klare Empfehlungen.
Hinweis zur Abkürzung: In der Kopfschmerzforschung steht „MSM“ häufig für „migraine-specific medication“ (z. B. Triptane) – nicht für Methylsulfonylmethan.[20]
Praktische Anwendung (in Abstimmung mit Arzt)
Dosierung und Titration
- Start: 500 mg 1× täglich zu einer Mahlzeit für 3–4 Tage.
- Wenn verträglich: Steigerung auf 2× 500 mg (≈1 g/Tag) für 1–2 Wochen.
- Optionaler getesteter Bereich: schrittweise bis ≤3 g/Tag in geteilten Dosen.[1–4]
- Evaluation nach 8 Wochen: Migränetage, Intensität, Akutmedikation dokumentieren; bei ausbleibendem Nutzen beenden.
Orientierungswerte – individuelle Faktoren (Diagnosen, Medikamente, Schwangerschaft/Stillzeit) berücksichtigen. Für eine neutrale Übersicht zu Produktformen beachten Sie die Angaben auf dem Etikett, z. B. bei MSM-Kapseln (OptiMSM).
Einnahme-Timing und Alltag
- Einnahme bevorzugt zu Mahlzeiten (Verträglichkeit).
- Konstant bleiben: feste Tageszeiten erleichtern die Beurteilung des Nutzens.
- Kombination mit Lebensstilmaßnahmen: regelmäßiger Schlaf, ausreichend trinken, moderater Ausdauersport, Entspannungsverfahren.[6]
Erfolgskontrolle
- Führen Sie ein Migränetagebuch (Attacken, Intensität, Auslöser, Akutmedikation).
- 8‑Wochen‑Check: ≥50 % Reduktion der Migränetage gilt als klinisch relevant (Richtwert aus Prophylaxe-Studien; auf die individuelle Situation anpassen).
Langsam auftitrieren, nach 8 Wochen nüchtern bilanzieren. Bleibt der Nutzen aus oder treten Nebenwirkungen auf, absetzen und ärztlich besprechen.
Sicherheit und Wechselwirkungen
Wer sollte vorsichtig sein?
- Schwangerschaft/Stillzeit: mangels Daten nur nach ärztlicher Rücksprache.
- Nieren- oder Lebererkrankungen: Nutzen‑Risiko individuell prüfen.
- Gerinnungsstörungen/Antikoagulation: Datenlage zu Interaktionen ist begrenzt; vorsichtshalber ärztlich abstimmen.
- Jugendliche: nur nach ärztlicher Empfehlung.
Wichtige Pflicht-Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
MSM gilt in üblichen Dosierungen als gut verträglich. Einzelne Unverträglichkeiten sind möglich – daher klein starten und Begleitmedikation berücksichtigen.
Weitere Maßnahmen mit Evidenz
Neben MSM werden einige Nährstoffe in Leitlinien und Reviews für die Prophylaxe diskutiert. Die Evidenzgrade unterscheiden sich:
Magnesium
Evidenz: gering–mittel (Grad C).[10,11]
Orientierung: 300–600 mg/Tag (z. B. Citrat/Oxid); häufigste Nebenwirkung: Durchfall.
Magnesium-Kapseln – bitte Etikett beachten.
Vitamin B2 (Riboflavin)
Evidenz: mittel (mehrere RCTs/Metaanalysen).[12,13]
Orientierung: 200–400 mg/Tag, häufig über 3 Monate getestet.
Coenzym Q10
Evidenz: gering–mittel (RCTs/Metaanalysen).[14,15]
Orientierung: 100–300 mg/Tag, häufig über ≥12 Wochen.
Für Magnesium, Vitamin B2 und CoQ10 gibt es – im Unterschied zu MSM – mehrere migränespezifische Studien. Auswahl und Dosierung bitte ärztlich abstimmen.
FAQ
Wie schnell wirkt MSM?Das ist individuell. Prüfen Sie den persönlichen Nutzen nach etwa 8 Wochen anhand eines Tagebuchs. Fällt keine Besserung auf, beenden Sie die Einnahme und besprechen Alternativen.
Darf ich MSM mit Triptanen kombinieren?Direkte Wechselwirkungen sind nicht bekannt, die Datenlage ist jedoch begrenzt. MSM ist nicht als Akutmedikation geeignet und ersetzt Triptane nicht. Bitte stimmen Sie Kombinationen mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt ab.[1]
Hilft MSM bei hormoneller (menstruationsassoziierter) Migräne?„Hormonelle“ Migräne meint Attacken rund um die Menstruation. Hier kommen – je nach Situation – ärztlich gesteuerte Strategien (z. B. Kurzzeit-Prophylaxe, Magnesium, verhaltenstherapeutische Maßnahmen) infrage. Für MSM gibt es hierzu keine spezifischen Studiendaten.
Zusammenfassung und Fazit
- Evidenz: Für MSM bei Migräne ist die Datenlage aktuell begrenzt; robuste RCTs fehlen.
- Potenzial: Anti‑Inflammations‑Mechanismen sind plausibel, ein gesicherter klinischer Nutzen bei Migräne ist bislang nicht belegt.
- Sicherheit: Insgesamt gutes Sicherheitsprofil in üblichen Dosierungen; Beobachtung auf individuelle Unverträglichkeiten.
- Nächste Schritte: Ärztlich abklären, niedrig starten, 8‑Wochen‑Check – parallel bewährte Maßnahmen (Schlaf, Trinken, Ausdauersport, Entspannung) fortführen.
Rechtlicher Hinweis (DE/EU): Für MSM existieren keine zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben zu Migräne nach der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006. Aussagen in diesem Artikel stellen keine Heilversprechen dar und ersetzen keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung.
Referenzen
- Butawan M, Benjamin RL, Bloomer RJ. Methylsulfonylmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement. Nutrients. 2017;9(3):290. PubMed-Eintrag | Volltext (PMC)
- Ahn H et al. Methylsulfonylmethane inhibits NLRP3 inflammasome activation. Cytokine. 2015;71(2):223–231. Studienübersicht
- Kim LS et al. Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial. Osteoarthritis Cartilage. 2006. Studie lesen
- Van der Merwe M, Bloomer RJ. Effects of MSM on exercise-induced stress and pain (Half-Marathon RCT). J Int Soc Sports Nutr. 2017. Volltext (PMC)
- Universitätsklinikum Freiburg. Methylsulfonylmethan – Informationsblatt. Dokument aufrufen
- Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG). Patienteninformationen. Überblick lesen
- Yücel M et al. Migraine and neuroinflammation: the inflammasome perspective. J Headache Pain. 2021. Artikel | Volltext (PMC)
- ICHD‑3 (Tension-type headache). Diagnosekriterien
- EFSA (2010). Scientific Opinion on claims related to MSM (versch. Indikationen). Stellungnahme
- Peikert A et al. Magnesium in Migraine Prophylaxis—Systematic Review. Headache. 2017. PubMed-Eintrag
- Peikert A et al. Prophylaxis of migraine with oral magnesium. Cephalalgia. 1996. Studie
- Schoenen J et al. High-dose riboflavin in migraine prophylaxis (RCT). Neurology. 1998. Studie
- Al-Kuraishy HM et al. Effect of Vitamin B2 on migraine prophylaxis—Systematic review/meta-analysis. Clin Nutr ESPEN. 2021. Studie
- Sándor PS et al. Coenzyme Q10 in migraine prophylaxis (RCT). Neurology. 2005. Studie
- Shahien R et al. Coenzyme Q10 supplementation—Meta-analysis. BMJ Neurol Open. 2021. Studie
- DMKG. Leitlinien-Übersicht. Leitlinien
- Orthoknowledge. „MSM – ein gutes Schmerzmittel“ (Blogbeitrag). Artikel
- GEOVIS. „MSM und seine Anwendungsbereiche“ (Blogbeitrag). Artikel
- Naturheilpraxis Rößle. „MSM-Infusion“ (Praxisinfo). Information
- Friedman DI et al. Acute migraine medication adherence—Daily diary study (Begriff „MSM“=migraine‑specific medication). Headache. 2017. Volltext (PMC)